Warum der Reformationstag in Deutschland so gegensätzlich gedeutet wurde, verrät mehr über die Gegenwart als über das 16. Jahrhundert.
Reformationstag im Geschichtsverständnis der Deutschen und seine aktuelle Würdigung
 Am 31. Oktober 1517, dem Abend vor Allerheiligen, schlug der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. In der „Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässe) ging es auf den ersten Blick vor allem gegen den Missbrauch des Ablasses und besonders gegen den geschäftsmäßigen Handel mit Ablassbriefen. Mit Ablassbriefen konnten sich „Sünder“ von auferlegten Strafen freikaufen.
Am 31. Oktober 1517, dem Abend vor Allerheiligen, schlug der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. In der „Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässe) ging es auf den ersten Blick vor allem gegen den Missbrauch des Ablasses und besonders gegen den geschäftsmäßigen Handel mit Ablassbriefen. Mit Ablassbriefen konnten sich „Sünder“ von auferlegten Strafen freikaufen.
Was auf den ersten Blick nur als Aufruf zur theologischen Diskussion erschien, setzte das päpstliche Finanzsystem und damit die Macht der Kirche unter Druck und führte zur Reformation. Diese nahm vor allem in Europa sehr unterschiedliche Formen an und wurde von unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften vorangetrieben und auch behindert. Ideologische Umwälzungen wie die Reformation sind nicht einfach nur fromme Erfindungen bedeutender Persönlichkeiten wie Martin Luther, sondern Ausdruck tieferliegender sozio-ökonomischer Widersprüche.
Die Reformation als frühbürgerliche Revolution
Luthers Thesen entsprangen nicht einfach theologischer Einsicht. Bewusst oder unbewusst reflektierte und beeinflusste Luther damit das Aufbegehren der Bauernschaft im Deutschen Bauernkrieg 1524/1525 und weiterer reformatorischer Strömungen, wie dem Calvinismus. Mit der Reformation begehrte eine sich entwickelnde bürgerliche Klasse gegen die feudalen Fesseln der katholischen Kirche auf. Die Säkularisation kirchlicher Güter, die Infragestellung päpstlicher Autorität und die Betonung des individuellen Gewissens entsprachen den Bedürfnissen aufstrebender Handels- und Frühkapitalisten.
Für Friedrich Engels, der sich seinerzeit intensiv mit geschichtlichen Themen befasste, kulminierte der
„große Kampf des europäischen Bürgertums gegen den Feudalismus … in drei großen Entscheidungsschlachten.“ (MEW, Bd. 22, S. 300)
Die erste war die „Reformation in Deutschland“.
„Im Calvinismus fand die zweite große Erhebung des Bürgertums ihre Kampftheorie fertig vor. Diese Erhebung fand statt in England…
Die große französische Revolution war die dritte Erhebung der Bourgeoise, aber die erste, die den religiösen Mantel gänzlich abgeworfen hatte und auf unverhüllt politischem Boden ausgekämpft wurde.“ (ebd. S. 300 – 303)
Zwei Staaten, zwei Instrumentalisierungen der Reformation
Zeitweilig und in unterschiedlichen Regionen Deutschlands war und ist der Reformationstag gesetzlicher Feiertag.
In der BRD:
In der BRD wurde Luther weitgehend entpolitisiert und als Held des „wahren Deutschen“ vereinnahmt. Die Reformation erschien als rein geistig-religiöses Ereignis, das die „abendländische Wertegemeinschaft“ stärkte. Die gesellschaftlichen Triebkräfte – die Interessen der Fürsten an Kirchenland, die finanziellen Nöte der Bauern, die wirtschaftlichen Ambitionen der Städte – blieben außerhalb der gesellschaftlichen Wertung und Würdigung.
In der DDR:
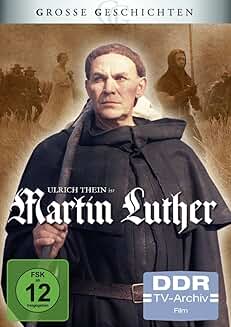 In den Anfangsjahren der DDR wurde Luther vor allem als „Fürstenknecht“ und „Bauernfeind“ gesehen. Später jedoch entwickelte sich eine differenziertere Sicht: Thomas Müntzer und der Bauernkrieg wurden als revolutionäre Volksbewegung gewürdigt. Luther – als widersprüchliche Figur – galt als fortschrittlich in der Auseinandersetzung mit Rom, als reaktionär im Bündnis mit den Fürsten gegen die Bauern.
In den Anfangsjahren der DDR wurde Luther vor allem als „Fürstenknecht“ und „Bauernfeind“ gesehen. Später jedoch entwickelte sich eine differenziertere Sicht: Thomas Müntzer und der Bauernkrieg wurden als revolutionäre Volksbewegung gewürdigt. Luther – als widersprüchliche Figur – galt als fortschrittlich in der Auseinandersetzung mit Rom, als reaktionär im Bündnis mit den Fürsten gegen die Bauern.
Die unterschiedliche Rezeption in beiden deutschen Staaten demonstriert, wie die gesellschaftliche Einordnung – in diesem Fall Geschichtsideologie – den jeweiligen ökonomischen Basisverhältnissen dient:
- In der BRD stabilisierte das spiritualisierte Lutherbild die kapitalistische Ordnung.
- In der DDR legitimierte das revolutionäre Müntzer-Bild die sozialistische Ordnung.
Beide Sichtweisen waren jedoch zum großen Teil einseitig. Eine wissenschaftliche Analyse muss beide Momente erfassen und widerspiegeln: die progressive Sprengkraft der frühbürgerlichen Ideologie UND ihre schnell erreichte Schranke im Bündnis mit der weltlichen Gewalt.
Heutige Bedeutung des Reformationstages
Der Reformationstag heute, in einem politisch wiedervereinigten Deutschland, bietet die Chance für eine synthetische Betrachtung. Wir können ihn als Moment begreifen, in dem die Widersprüche einer Übergangsepoche in religiöse Formeln gegossen wurden – deren reale Grundlage jedoch in den sozialen Kämpfen, den Eigentumsverhältnissen und den Klasseninteressen des 16. Jahrhunderts lag.
Keine fortschrittliche Bewegung ist frei von Widersprüchen, und jede revolutionäre Umwälzung produziert ihrerseits neue Gegensätze, die wiederum nach Lösung drängen. In diesem Sinne ist der Reformationstag nicht nur kirchliches Gedenken, sondern Anlass zur Reflexion über die Triebkräfte geschichtlichen Wandels überhaupt.
Halloween – Abend und Nacht vor Allerheiligen
Der Reformationstag verliert in Westeuropa und besonders in Gesamtdeutschland seit Beginn der 1990er Jahre zunehmend an protestantischer Bedeutung. Demgegenüber wächst vor allem unter der jüngeren Bevölkerung die Bedeutung von Halloween. Beide Feste koexistieren jedoch nicht als gleichwertige Alternativen, sondern als Ausdruck unterschiedlicher gesellschaftlicher Entwicklungen:
-
Der Reformationstag gilt als Relikt konfessioneller und später ideologischer Auseinandersetzungen.
-
Halloween erscheint als willkommener Anlass, um den Warenumsatz anzuregen und „Kaufzwänge“ anzuregen.
In Halloween fallen zeitlich mehrere strukturelle Entwicklungen zusammen:
-
Die „Kultur“ des Schaurigen: Halloween wurde zum perfekten Vehikel, um den Konsum „schaurig-schöner“ Waren anzuregen:
„Halloween wird immer mehr auch zu einem Wirtschaftsfaktor. Das Geschäft mit Grusel-Fratzen, Totenköpfen und entsprechenden Süßigkeiten blüht. Der Handel macht rund 83 Millionen Euro mehr Umsatz rund um diesen Tag – allein in Bayern.“ (BR, 31. 10. 2025)
„Der Einzelhandel in Deutschland kann sich auch in diesem Jahr zu Halloween wieder über mehr als 500 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz freuen.“ (einzelhandel.de/halloween)
-
Postmoderne Entleerung: Im Gegensatz zum Reformationstag mit seinem spezifischen historisch-ideologischen Hintergrund bietet Halloween eine enthistorisierte, austauschbare Feierform, die scheinbar keine gesellschaftspolitischen Standortbestimmungen erfordert.
-
Globalisierungsfolge: Als US-amerikanischer Import spiegelt Halloween die kulturelle Hegemonie des späten 20. Jahrhunderts wider – ähnlich wie die Reformation einst den aufstrebenden deutschen Frühkapitalismus spiegelte.
Über den Konsum zu Halloween und dessen keltische Wurzeln wird weitgehend verdrängt, dass unter Satanisten und in Hexenkreisen ist Halloween nach wie vor der oberste Feiertag, ein Fest des Schreckens und des Todes.
Nachtrag vom 02. 11. 2025:
Markus Langemann: Fratzen der Gegenwart – über Halloween, Konsum und den Verlust des Maßes



Hervorragend analysiert! Die witzige Entlarvung von Halloween als reinen Konsumfestival, das keltische Wurzeln verdrängt, während der Reformationstag (jetzt mit 5/5 Punkten!) als ernstzunehmendes historisches Moment gilt, ist einfach brilliant. Man lernt wirklich mehr über die heutige Warenkultur als über die 16. Jahrhundert-Klassenkämpfe – was zeigt, was wirklich zählt heute, nicht wahr? Der文章 ist eine wunderbare Mischung aus geschichtlicher Tiefe und heutigem Witz, eine echte Bereicherung für den Kulturkalender!